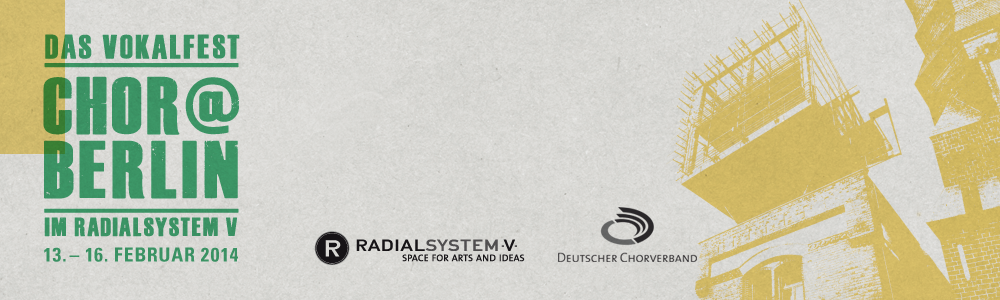Von der ersten Auflage an im Jahr 2011 versteht sich Chor@Berlin als Plattform und Experimentierfeld für neue, innovative Aufführungsformate. Auch dieses Jahr hat das Thema Konzertgestaltung einen festen Platz im Programm – sowohl auf der Bühne als auch in den Workshops. So luden gestern Dramaturg Jochen Sandig (Foto, rechts) und Dirigent Nicolas Fink zum Gespräch über “Chancen und Risiken inszenierter Chormusik” ein, heute ging es bei Ilka Seifert um “Konzertdesign”. Einige der Erkenntnisse haben wir zusammengetragen.
Dramaturg Jochen Sandig und Dirigent Nicolas Fink präsentierten den Workshopteilnehmern zwei Beispiele ihrer bisherigen Zusammenarbeit, in der konzertante Chormusik theatral bzw. choreographisch in Szene gesetzt wird: das Deutsche Requiem von Johannes Brahms als “human requiem” mit dem Rundfunkchor Berlin (auch im Rahmen von Chor@Berlin 2012) und “Figure Humain” mit dem Vocalconsort Berlin als choreographisch-musikalische Raumerkundung von Sasha Waltz & Guests anlässlich der Eröffnung der Elbphilharmonie Hamburg (und in szenisch reduzierter Fassung als Eröffnungskonzert von Chor@Berlin 2017).
 Für Dirigent Nicolas Fink sind Projekte wie diese “ein wunderbares Vehikel, um Musik für alle Bevölkerungsschichten neu erlebbar zu machen”. Aus seiner Sicht hat klassische Musik immer noch einen elitären Anstrich, zu dem etwa auch das bürgerliche Konzertritual mit der entsprechenden schicken Kleidung, dem Sekt in der Pause und so weiter gehört – mit der Musik selbst habe dieser Rahmen, der viele Menschen vom Konzerterlebnis ausschließt, jedoch nichts zu tun.
Für Dirigent Nicolas Fink sind Projekte wie diese “ein wunderbares Vehikel, um Musik für alle Bevölkerungsschichten neu erlebbar zu machen”. Aus seiner Sicht hat klassische Musik immer noch einen elitären Anstrich, zu dem etwa auch das bürgerliche Konzertritual mit der entsprechenden schicken Kleidung, dem Sekt in der Pause und so weiter gehört – mit der Musik selbst habe dieser Rahmen, der viele Menschen vom Konzerterlebnis ausschließt, jedoch nichts zu tun.
Dazu komme, dass wir in einer sehr visuellen Welt leben, und viele Mühe hätten, sich länger auf rein auditive Impulse zu konzentrieren – was Fink gar nicht als Vorwurf, sondern als nüchterne Feststellung meint, auf die man reagieren müsse. Umgekehrt liege in der szenischen Gestaltung aber auch die große Chance, bei den Besuchern ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was eigentlich im Gehör passiere – also letztendlich alle Sinne zu schärfen.
 Auch Jochen Sandig plädiert dafür, Konzertritual und das eigentliche Musikerlebnis erst einmal gedanklich voneinander zu trennen. Er arbeitet seit vielen Jahren besonders gerne mit Chören zusammen, da die Stimme wie kein anderes Instrument den unmittelbaren Kontakt zwischen Menschen ermögliche, was er in seine dramaturgischen Ideen versuche zu integrieren. Schließlich seien die Sängerinnen und Sänger gleichzeitig auch immer Privatpersonen, oder, wie Sandig sagt, “lebende, atmende Menschen”, die man durch die szenischen Elemente – etwa eine besondere, überraschende Nähe zu den Zuhörern – einerseits in den Fokus und andererseits in eine Wechselbeziehung mit dem Publikum setze.
Auch Jochen Sandig plädiert dafür, Konzertritual und das eigentliche Musikerlebnis erst einmal gedanklich voneinander zu trennen. Er arbeitet seit vielen Jahren besonders gerne mit Chören zusammen, da die Stimme wie kein anderes Instrument den unmittelbaren Kontakt zwischen Menschen ermögliche, was er in seine dramaturgischen Ideen versuche zu integrieren. Schließlich seien die Sängerinnen und Sänger gleichzeitig auch immer Privatpersonen, oder, wie Sandig sagt, “lebende, atmende Menschen”, die man durch die szenischen Elemente – etwa eine besondere, überraschende Nähe zu den Zuhörern – einerseits in den Fokus und andererseits in eine Wechselbeziehung mit dem Publikum setze.
Nicolas Fink weist darauf hin, dass viele Sängerinnen und Sänger eine unglaublich enge Beziehung zu bestimmten Werken hätten, etwa weil sie diese, zum Beispiel Brahms‘ Requiem, vielleicht schon seit mehr als 30 Jahren immer wieder singen würden. Dies bedeute einen ungeheuren Schatz an persönlichen Erfahrungen, aus dem man sehr viel mehr schöpfen könne, wenn sich die Sänger einmal nicht in einer Stimmgruppe “verstecken” würden.
 Der Anspruch, neben dem Singen auch noch theatral agieren zu müssen, sei für viele Sängerinnen und Sänger jedoch nicht einfach. So seien die genannten Produktionen in langen, intensiven und oftmals für alle Beteiligten anstrengenden Prozessen entstanden. Auch beim “human requiem”, das sich letztlich zu einem riesigen Erfolg mit Aufführungen auf der ganzen Welt entwickelte, habe mindestens die Hälfte der Sängerinnen und Sänger der Projektidee skeptisch oder sogar ablehnend gegenübergestanden.
Der Anspruch, neben dem Singen auch noch theatral agieren zu müssen, sei für viele Sängerinnen und Sänger jedoch nicht einfach. So seien die genannten Produktionen in langen, intensiven und oftmals für alle Beteiligten anstrengenden Prozessen entstanden. Auch beim “human requiem”, das sich letztlich zu einem riesigen Erfolg mit Aufführungen auf der ganzen Welt entwickelte, habe mindestens die Hälfte der Sängerinnen und Sänger der Projektidee skeptisch oder sogar ablehnend gegenübergestanden.
Dies habe auch damit zu tun, dass in der Ausbildung der Sänger das Thema Bühnenpräsenz eine untergeordnete Rolle spiele, wie Fink erläuterte. Denn die Sänger in Rundfunkchören etwa hätten sich im Laufe ihrer Karriere irgendwann mehr oder weniger bewusst dafür entschieden, eben nicht an die Oper zu gehen, sondern ihr Hauptaugenmerk auf CD-Aufnahmen zu legen.
Fink nennt drei Hauptprobleme für Sänger in Zusammenhang mit szenischen Projekten: das komplette Werk auswendig singen zu müssen, teilweise quasi solistisch agieren zu müssen, weil die Stimmgruppen auseinandergerissen werden, und die bereits erwähnte Nähe und der direkte Blickkontakt mit den Publikum. Hier müsse man dem Chor in – teilweise mühseliger – Überzeugungsarbeit die Ängste nehmen, dürfe den Sängerinnen und Sängern aber auch nie etwas aufzwingen, was sie nicht können oder wollen.
“Wenn jemand einfach nicht tanzen kann oder will, sollte man ihn das auch nicht machen lassen”, sagt auch Sandig. Deshalb arbeite er viel mit ganz natürlichen Gesten und Bewegungen, die wirkungsvoll in Szene gesetzt werden. Und auch Fink betont, dass musikalische Stabilität und Sicherheit extrem wichtig seien: “Erst dann kann man anfangen, frei zu werden.” Wenn diese Grundsicherheit nicht gegeben ist , sollte man auf derartige Projekte besser verzichten – da sind sich beide einig.
Abschließend betonte Sandig, dass es ihm grundsätzlich wichtig sei, nie oberflächlich aufgesetzte choreografische Ideen umzusetzen, sondern immer vom Werk selbst auszugehen. So würden etwa Opernchöre oft überagieren, wodurch die musikalische Qualität teilweise eine untergeordnete Rolle spiele. “Die Musik muss immer das Primat behalten”, sagt Sandig, “sie darf nicht leiden.” Seine Ideen entwickle er deshalb immer aus der Partitur selbst, etwa aus dem Aufbau des jeweiligen Stückes. Auch Fink betont, dass Musik und szenische Elemente immer als absolute Einheit gedacht und entwickelt werden müssen: “Ohne einen echten Dialog auf Augenhöhe zwischen musikalischer und dramaturgischer Leitung sind solche Projekte unmöglich.”
 Am Samstag erklärte Ilka Seifert (Foto links) in ihrem Workshop, was unter dem Begriff “Konzertdesign” zu verstehen ist: Ein Konzert wird nicht nur im Hinblick auf die Stückfolge und die Mitwirkenden konzipiert, sondern als komplexes Erlebnis mitsamt Publikum und Aufführungsort gedacht und entworfen.
Am Samstag erklärte Ilka Seifert (Foto links) in ihrem Workshop, was unter dem Begriff “Konzertdesign” zu verstehen ist: Ein Konzert wird nicht nur im Hinblick auf die Stückfolge und die Mitwirkenden konzipiert, sondern als komplexes Erlebnis mitsamt Publikum und Aufführungsort gedacht und entworfen.
Ausgehend von der Frage “Was ist überhaupt ein Konzert?” griff Seifert zunächst auf einige historische Beispiele zurück, anhand derer sie zeigte, dass sich die Präsentation von Musik im Laufe der Geschichte stark gewandelt habe. So hätten Musiker in früheren Jahrhunderten lediglich den Rahmen für bestimmte Anlässe wie offizielle Akte, Bankette oder Feste geschaffen. Erst im 19. Jahrhundert habe sich das bürgerliche Konzertritual entwickelt, das sich in der klassischen Musik im Grunde bis heute halte.
Besagter Rahmen aber – und damit spannte Seifert den Bogen zurück zu den Ideen von Nicolas Fink und Jochen Sandig – bedeutete für viele Menschen eine große Hemmschwelle, überhaupt ins Konzert zu gehen. Mit Blick auf das immer älter werdende Konzertpublikum stelle sich für den Kulturbetrieb insofern die wichtige Frage, wie man das Konzerterlebnis von solchen Ritualen frei machen kann.
Programmdramaturgie, Kontextualisierung, das Einbeziehen weiterer Medien, die Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern anderer Disziplinen und das Setting von Musiken und Zuhörern stellen in diesem Sinne variable Faktoren dar, die sich auf das jeweilige Programm und Publikum neu ausrichten. Sie müssen mit der Musik in einem inhaltlichen Bezug stehen (auch hier stimmt Seifert mit Fink und Sandig überein) und haben im Zusammenspiel eine besonders intensive Konzerterfahrung zum Ziel.